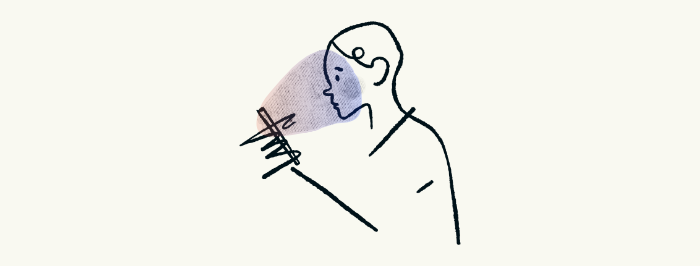Von Jan Nicklaus
Schwerpunkt
Das deutsche Bildungssystem wird oft kritisiert: Zu wenig Chancengleichheit, zu große regionale Unterschiede, zu wenig digital. Besonders wenig Gefallen finden aber gerade junge Erwachsene an der Auswahl der unterrichteten Fächer. 2015 fand folgender Tweet der Nutzerin @nainablabla große mediale Beachtung:
„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ´ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“
Die zugrundeliegende Forderung ist nicht neu: Die Schule soll mehr technische Fähigkeiten unterrichten, die im „echten Leben“ weiterhelfen. Zurückstehen kann demgegenüber die Auseinandersetzung mit längst vergangenen Literaturepochen. Auch Mathematik („Wieder ein Tag, an dem ich den Satz des Pythagoras nicht angewendet habe“) und Latein („Das spricht doch keiner mehr“) wird heute kaum noch Bedeutung zugesprochen. Dafür soll neben diversen Bereichen der Haushaltsfinanzen vor allem eines unterrichtet werden: Informatik. Konkret gemeint ist damit vor allem Programmieren als praktische Fertigkeit; dennoch erwarten Vertreter*innen der Forderung ein erhöhtes Verständnis für alles, was mit Computern zu tun hat. Weder für das Erlernen des Programmierens noch für die Vermittlung eines informatischen Verständnisses ist die Schule aber der richtige Ort.
Traditionelle Schulbildung verfolgt eine induktive Methode: Aus spezifischen Beispielen und technischen Einzelfertigkeiten sollen Schüler*innen ein abstraktes Verständnis für eine Materie, etwa analytische Geometrie oder den historischen Kontext und die korrespondierenden Ausdrucksformen einer Epoche, gewinnen. Die abstrakten Kenntnisse sind dabei angesichts der verfügbaren Unterrichtszeit und der Interessen- und Entwicklungshorizonte der Schüler*innen notwendigerweise oberflächlich. Die Schule vermittelt nur einen Ausschnitt verschiedener Disziplinen, die in einem Studium oder einer Ausbildung vertieft werden können.
Auch Programmieren ist wie das Anfertigen von Steuererklärungen oder ein Grundwissen im Bereich des Miet- und Versicherungsrechts im Grundsatz eine zunächst rein technische Fertigkeit, die von einem komplexeren Grundsystem abhängt. Nur ist in diesen Fällen das zugrundeliegende System nicht sinnvoll abgrenzbar. Der Sprung auf die Ebene eines oberflächlichen abstrakten Verständnisses kann nicht gelingen, weil es diese Ebene nicht gibt. Wer die Grundsätze des Umgangs mit Vektoren im dreidimensionalen Raum verstanden hat, kann diese Grundsätze anwenden und kommt zu praktisch verwertbaren Ergebnissen. Wer die Vorschriften des Mietrechts im BGB kennt, hat nichts gewonnen, wenn Normen des allgemeinen Teils, andere zivilrechtliche Rechtsquellen oder das öffentliche Recht zu einem anderen Ergebnis führen. Und wer if/else und while-Loops anwenden kann, hat dadurch nur ein marginal besseres Verständnis von den Data-Science-Algorithmen großer Konzerne.
Ein effektiver Schulunterricht müsste hier also letztlich den Stoff eines ganzen Studiengangs in komprimierter Form vermitteln. Von der tatsächlichen Unmöglichkeit eines solchen Vorhabens abgesehen ist dabei das für den Einstieg in jedes Fachgebiet erforderliche Grundlagenwissen zu beachten: Latein wird etwa nicht von Anfang an unterrichtet, weil das Erlernen ein Verständnis der deutschen Grammatik und des allgemeinen Aufbaus einer Sprache erfordert. Spiegelbildlich setzt selbst ein oberflächliches Verständnis der Naturwissenschaften ein gewisses Verständnis der Mathematik voraus.
In gleicher Weise ist sowohl der Informatik als auch dem juristischen Denken ein logischer Umgang mit Sprache immanent, der durch ein Grundverständnis sowohl der Sprache als auch der Mathematik zumindest erheblich erleichtert wird. Unterricht kann in diesen Bereichen schon aus Mangel an diesem Grundverständnis im frühen Schulalter nur wenige Schüler*innen erreichen.
Es ist nach alledem fraglich, ob ein Verständnis gerade dieser Fachgebiete so zentral für das Leben im 21. Jahrhundert ist, dass es jeder*m vermittelt werden müsste. Den meisten Anwender*innen dürfte die jeweilige praxisorientiert erlernte technische Fertigkeit genügen. Für das Erlernen einer Fähigkeit ohne theoretisches Verständnis braucht man aber keine Lehrkräfte, sondern lediglich Lernressourcen. Der Lernprozess ist intellektuell keineswegs anspruchsvoll, es braucht nur wiederkehrende Übung. Bei dieser kann aber der klassische Frontalunterricht gerade nicht weiterhelfen. Nicht umsonst geben viele Programmierer*innen an, die Fähigkeit eigenständig erlernt zu haben. Auch ist fraglich, ob das Erlernen dieser technischen Fertigkeiten zu Schulzeiten wirklich erstrebenswert ist. Eine Schulklasse, die, angetrieben durch die Vorstellung einer vorbildlich organisierten Zukunft, begeistert Hausaufgaben zum Thema Steuererklärungen macht, scheint schwer vorstellbar; demgegenüber ist das Einlesen im Bedarfsfall immer noch möglich. Gerade für Arbeitnehmer*innen wird die Einkommensteuererklärung ohnehin zunehmend trivial. Auch zu gängigen Rechtsproblemen gibt es viele kostenlose Ressourcen und inwiefern es die Welt weiterbringt, wenn alle Absolvent*innen eine „Hello World“-Anwendung in Java schreiben können, ist nicht ersichtlich. Mir erscheinen daher vom Staat bereitgestellte, inhaltlich zuverlässige und problemorientiert gegliederte Quellen zielführender als ein Vorbereitungsunterricht in der Mittelstufe, der eine Lebenswirklichkeit abbildet, die den meisten Schüler*innen noch sehr fremd ist und der ihnen deshalb kaum helfen kann.
Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll sein kann, etwa im Wirtschaft & Politik- oder im Deutschunterricht eine Einheit zur Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer*innen oder zu den verschiedenen Arten von Versicherungen einzubauen, vergleichbar mit dem Einüben des Verfassens von Lebensläufen und Bewerbungsanschreiben. Ich glaube aber, dass eine allgemeinbildende Schule ihre Aufgabe durch die Vermittlung der grundlegenden Systeme Sprache und Logik besser erfüllt als durch überladene Konzepte zur Vermittlung von praktischen Fertigkeiten, die diese Systeme lediglich anwenden. Denjenigen, die sich für einen dieser Bereiche ernsthaft interessieren, wird so immerhin eine Grundlage für eine spätere Berufsausbildung geboten.
Als Destillat der Erwartungen vieler Erwachsener an schulischen Informatikunterricht verbleibt schließlich eine Verbesserung der Medienkompetenz. Teilweise wird sogar hierfür ein eigenes Fach gefordert. Zwar handelt es sich hierbei wohl um ein hinreichend abgrenzbares, abstraktes System, der Forderung ist aber entgegenzuhalten, dass der geforderte Themenkomplex bereits zentraler Unterrichtsinhalt ist. „Medienkompetenz“ meint nichts anderes als die kritische Auseinandersetzung mit Quellen. Dies ist aber elementares Element nahezu aller sozialwissenschaftlichen Fächer und auch des Sprachunterrichts. Das Problem einer „postfaktischen“ Informationskultur, der durch die Vermittlung von „Medienkompetenz“ entgegengewirkt werden soll, ist weniger das Fehlen der abstrakten Fähigkeit zur Quellenkritik als vielmehr die Unterordnung dieser Quellenkritik unter ein gefestigtes Weltbild des einzelnen.
Abschließend ist Kritiker*innen zuzustimmen, dass die technische Fähigkeit, eine Gedichtanalyse in vier Sprachen schreiben zu können, im Erwachsenenalter nur selten unmittelbar anwendbar ist. Die dahinterstehende Fähigkeit, Struktur und Effekt von Sprache zu erkennen sowie Motive und Themen der Autor*innen herauszuarbeiten, hat aber an Relevanz keineswegs verloren. Mir erscheint die Vermittlung eines solchen Grundlagenverständnisses sogar weitaus wichtiger als Mietrecht für Achtklässler*innen.
freiraum #66