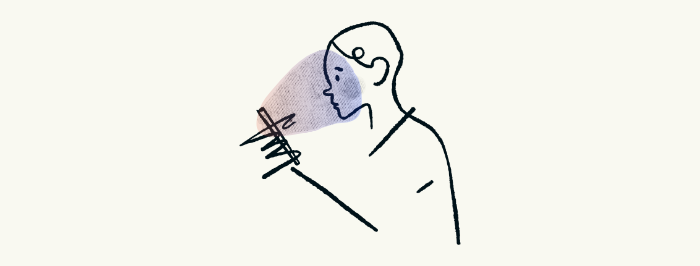Antisemitismusprävention in Schulen und wie es besser gelingen könnte. Von Moritz Meier
Schwerpunkt
Der Antisemitismus ist historisch wie zeitgenössisch eine außergewöhnliche Form des Menschenhasses. Millionen von Juden und Jüd*innen wurden über Jahrhunderte marginalisiert, diskriminiert, vertrieben und ermordet. Antisemitische Weltbilder standen den Täter*innen dabei zur Seite, entwickelten sich stets weiter und haben so ihre ganz eigene „Ideengeschichte“. Spätestens mit der Shoah ist die Antisemitismusprävention zu einer gesamtpädagogischen Aufgabe geworden, die keiner weiteren Rechtfertigung benötigt. So schrieb der Begründer der „Kritischen Theorie“, Theodor W. Adorno, treffend: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen.“ In der theoretischen Antisemitismusforschung wurde sich früh dieser Aufgabe angenommen, indem mit verschiedensten Ansätzen nach einer Erklärung gesucht wurde, wie und warum Judenhass überhaupt entsteht und daraufhin zu seinen benannten Folgen führt. Die praktischer orientierten Erziehungs- und Bildungswissenschaften hingegen sollten, um dem Anspruch gerecht zu werden, in Deutschland erst allmählich mit Beginn der 1980er-Jahre diese Erkenntnisse und viel mehr die der historischen Forschung aufklärerisch an die jüngeren Generationen weitergeben. Den vielen Initiativen und Organisationen zum Trotz, die antisemitismuskritische Bildungsarbeit leisten, ist Antisemitismus dennoch weltweit nicht nur eine verlässliche Konstante, sondern äußert sich in den letzten Jahren zunehmend selbstbewusst und aggressiv, auch an Schulen in Deutschland. Als maßgebliche Sozialisationsinstanzen stehen Schulen in der direkten gesellschaftlichen Mitverantwortung, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mindestens vorzubeugen. Wie könnte also ein didaktischer Ansatz antisemitismuskritischer Bildung aussehen, der einen höheren Präventionserfolg versprechen würde, als es der über den Nationalsozialismus aufklärende Geschichtsunterricht bisher vermag? In keinem Fall soll letzterem seine unermessliche Relevanz abgesprochen werden. Es zeigte sich jedoch recht eindeutig, dass er allein nicht dazu beitragen kann, autoritäre und antisemitische Weltbilder zu bekämpfen. Schüler*innen können die Maßnahmen der deutschen Regierung von 1933 bis 1945 und ihrer Folgen im Detail beschreiben, aber es erfolgt kein treffender Transfer auf den gegenwärtigen Antisemitismus. Wie geht es besser?
Die „Verbindung von Weltanschauung und Leidenschaft“ (S. Salzborn), welche den Kern des Antisemitismus ausmacht, baut maßgeblich auf negativen Emotionen auf. Der Hass auf alles Jüdische dient der Befriedigung solcher Gefühle. Das antisemitische Weltbild kann sehr unterschiedlich aussehen, weil das Phänomen eine enorme Bandbreite an Spielarten aufweist: christlich, völkisch-rassistisch, sekundär, antizionistisch und islamisch sowie national und antiliberal oder antikapitalistisch und strukturell (freiraum-Ausgabe 62). Gemeinsam haben alle Formen „das Gerücht über die Juden“ (T.W. Adorno). Wie Juden und Jüd*innen sich tatsächlich verhalten ist dabei nicht relevant, denn nach antisemitischer Logik wird abstrakt gefühlt und konkret gedacht, während es eigentlich andersherum sein sollte: Das konkrete Denken äußert sich beispielsweise im Bild von Juden und Jüd*innen als „Strippenziehende“ des kapitalistischen Wirtschaftssystems und in der Personifikation von scheinbar Widersprüchlichem, abstraktes Fühlen hingegen etwa in der Identifikation mit Repräsentant*innen eines künstlichen, meist nationalen „Wir“, also beispielsweise einer Fußballnationalmannschaft. Die sozialwissenschaftliche Antisemitismusforschung wurde besonders von der „Frankfurter Schule“ geprägt. Mit einem interdisziplinären Ansatz begründeten Adorno und Horkheimer in der „Kritischen Theorie“, dass die Hauptmechanismen antisemitischer Weltbilder Aggressionsverschiebungen (also das Aussuchen von „Sündenböcken“, auf die meist in einer Krise entstandene Hassgefühle abgeschoben werden können) und das der Psychoanalyse entnommene Konzept der Projektion (eigene Bedürfnisse und Triebe, die gesellschaftlich delegitimiert sind, werden Juden und Jüd*innen zugeschrieben) sind. Die primäre „Motivation“ besteht dabei in der Abwehr von Schuldgefühlen, welche durch Projektionen erfolgt und wiederum zu einem Vernichtungswillen führt, wie psychoanalytische Antisemitismustheorien darlegen. Weil Antisemitismus sich also unabhängig vom Handeln oder auch von der Existenz von Juden und Jüd*innen entwickelt, kann er nicht, wie sonst in den Sozialwissenschaften üblich, anhand von Interaktionen untersucht werden: „Wenn man Antisemitismus nicht als Resultat einer Beziehung ansieht, bleibt nur die Analyse der Antisemiten.“ (W. Bergmann). Die heute viel beachtete positivistische, also auf Fragebögen und Empirie basierende Vorurteils- und Meinungsforschung hat sowohl theoretische Überlegungen als auch die emotionsbasierte Komponente der Antisemitismusforschung weitestgehend ausgeklammert und wird deshalb aus antisemitismuskritischer Sicht stark bemängelt. Auch der Unterschied zum Rassismus verschwimmt schnell darin: Die rassistische Zuschreibung ist konkret, die antisemitische jedoch eine "mysteriöse Unfassbarkeit, Abstraktheit und Allgemeinheit" (M. Postone). Auch muss Antisemitismus sich, wie in den benannten Spielarten erkennbar, nicht ausschließlich völkisch-rassistisch begründen.
Darin liegt ein großes Problem im Umgang mit Antisemitismus an Schulen. Das Phänomen wird unterschätzt, relativiert und in seiner Vielfältigkeit an Spielarten meist nicht begriffen, sondern unter Rassismus als Teilbereich subsumiert. In deutschen Schulen wurde im Grundsatz dem Fach Geschichte die Verantwortung für ein „Nie wieder!“ übertragen. In Anbetracht des offenkundigen Widerspruchs zwischen Antisemitismus und dem demokratisch-freiheitlichen Fundament des Grundgesetzes wird weiterhin die Aufgabe der Antisemitismusprävention dem Politik- beziehungsweise Sozialwissenschaftsunterricht zugeordnet. Die Bilanz der schulischen antisemitismuskritischen Bildungsarbeit sieht allerdings sehr problematisch aus. Oft sehen sich Lehrkräfte mit antisemitischen Äußerungen der Schüler*innen überfordert, was zu Relativierungen führt, oder verstärken diese durch die eigenen teils unterbewussten Antisemitismen. Zudem wird die eigene Verantwortung gerne an außerschulische Lernorte abgewiesen. Einen spezifischen Ansatz antisemitismuskritischer Didaktik boten erst letztes Jahr Alexandra Kurth und Samuel Salzborn, indem sie die allgemeine, weder fach- noch themengebundene Förderung von abstraktem Denken und konkreter Empathie hervorheben und damit unmittelbar auf ihre theoretischen Ausführungen zum Hintergrund von Antisemitismus antworten. Auch das Einbeziehen der Betroffenenperspektive durch Zusammentreffen mit jungen Juden und Jüd*innen oder der Besuch von Synagogen wird gerne als Mittel zur Prävention genutzt. Dass antisemitismuskritische Didaktik nur präventiven Charakters und auf Nicht-Antisemit*innen ausgerichtet sei, sich aber nicht um bereits verfestigte Antisemitismen der Schüler*innen kümmern könne, weil das die Aufgabe der Justiz wäre, scheint aktuell allgemeingültige Perspektive der Schulen zu sein.
Ein zentrales Problem der Nicht-Adressierung von Antisemit*innen, wie sie von Salzborn und Kurth als Prämisse formuliert wurde, liegt darin, dass jene Antisemit*innen nur allzu häufig Teil der Klasse sind und gegebenenfalls klassendynamische Prozesse bestimmen. Dabei müssen sie sich ihrem Antisemitismus nicht einmal bewusst sein, wie es die beiden Wissenschaftler*innen an anderer Stelle anerkennen: „Relevant ist dabei auch, dass man antisemitische Ressentiments vertreten kann, ohne ein Bewusstsein darüber haben zu müssen, ein*e Antisemit*in zu sein […].“ Aus diesem Grund ist auch der Ansatz des Zusammentreffens mit Juden und Jüd*innen eine nicht unwahrscheinliche Gefahr für letztere, im Klassenraum oder während der Führung in der Synagoge sowohl von Lehrkräften als auch von Schüler*innen wiederum mit realem Antisemitismus konfrontiert zu werden. In Anbetracht dieser Problemlage möchte ich den Vorschlag machen, dass zuallererst die in der theoretischen Antisemitismusforschung vielfach betonte emotionale Komponente und Mechanik des Antisemitismus didaktisch aufbereitet, altersgerecht gespiegelt und sichtbar gemacht werden muss, damit sie im Anschluss dekonstruiert, als solche erkennbar gemacht und delegitimiert werden kann, um den gegebenenfalls durch Emotionen geblockten Zugang zu Fakten und Wissen wieder zu öffnen. In der unterrichtspraktischen Konzeption ist Kindern und Jugendlichen dabei die Theorieabneignung zuzutrauen, auch wenn es zunächst paradox erscheint, über rationalisierte Konzepte emotionsreflexiv zu dekonstruieren. Dennoch sind Gefühle ein Phänomen, das Kinder und Jugendliche egal welchen Hintergrunds zu erkennen vermögen, wenn auch nicht immer bei sich selbst, so doch bei anderen in einer Gruppe. Das trainiert gleichzeitig wiederum die emotionale Intelligenz. Vergleichsweise ist hier der von der Leiterin des Kompetenzzentrums des Zentralrats der Juden genutzte „Dialogische Reflexionsansatz“ zur Seite zu ziehen, welcher mittels kritischer Reflexion der gesellschaftlichen Tradierungen, der eigenen Emotionen und Biografie in einer Gruppe von Teilnehmenden die selbstbezogene „Beobachtung, Interpretation und Repositionierung“ verfolgt (M. Chernivsky). Auf diese Art und Weise würden alle Schüler*innen und Schüler unabhängig vom individuellen Niveau des Antisemitismus oder eines Anti-Antisemitismus gleichermaßen adressiert werden. In Gruppenarbeiten könnten sie voneinander profitieren und sich im Erfolgsfall gegenseitig helfen, zu bewussteren, reflektierteren Menschen zu werden. Denn erst wenn ein Subjekt sich vollumfänglich dessen bewusst ist, dass sein Ressentiment oder sein Hass aus einer emotionalen Motivation entstand und es nicht das antisemitische Argument an und für sich ist, das es zu seinem Weltbild bringt, sondern eben die Befriedigung der sichtbar gemachten emotionalen Bedürfnisse, hat es eine Chance, Abstand von diesen Emotionen zu nehmen, einen „kühlen Kopf“ zu fassen und die relevanten, rationalen Gegenargumente in Form von faktischem Wissen zuzulassen und somit eine „Immunität“ aufzubauen. Dieser Ansatz ist unter keinen Umständen ein Allheilmittel, sondern bildet neben der Kompetenz zu abstraktem Denken und konkreter Empathie lediglich eine ergänzende Voraussetzung, auf welche anschließend Aufklärung und Wertevermittlung aufbauend gelehrt werden müssen. Aufgrund des emotionalen Fundaments reichen Fakten und Wahrheit im Sinne einer rein rational gegenargumentierenden Wissensvermittlung eben nicht aus, sondern müssen einleitend vom vorgestellten emotionsreflexiven Ansatz ergänzt werden. Erst nach Bewusstwerden der emotionalen Motivation von antisemitischen Gedanken kann eine bei Antisemitismen vorhandene Blockade für harte Fakten aufgelöst und langfristig reflektiert, dekonstruiert und zukünftig vorgebeugt werden. Ob mein Ansatz in der Praxis tatsächlich so erfolgversprechend aufgeht, wie er in der Theorie klingt, oder ob er als naive Unterschätzung emotionaler Starrheit und der damit einhergehenden Herausforderungen entpuppt, muss noch geprüft werden. Dabei muss kritisch und penibel beachtet werden, dass extreme Fälle von antisemitischen Emotionen, die von Schüler*innen in Gruppen veräußert werden könnten, weiterhin als solche benannt, verurteilt und in der Konsequenz auch sanktioniert werden müssen und dass für diese weder gespielte noch authentische Empathie aufgebracht werden darf. Die Empathie gilt weiterhin den Juden und Jüd*innen, die als Individuen und im Kollektiv betroffen sind und zu Opfern von Antisemitismus werden, unter dessen Folgen sie leben. Dass vom emotionsreflexiven Ansatz keine komplettierte Lösung eines so komplexen Phänomens wie dem Antisemitismus ausgeht, ist völlig offensichtlich. Die Hoffnung, dass er die aktuelle antisemitismuskritische Didaktik zumindest verbessert und ein verständnisvolleres Bewusstsein für die Problematik schafft, bleibt bestehen.
Adorno fordert in seiner Theorie der Halbbildung zur Selbstkritik des eigenen Halbwissens auf, während sein Partner und Freund Max Horkheimer den Bildungsbegriff kritisiert: Wenn wir an Bildung denken, dann denken wir an unsere Schulzeit, an Universitäten oder Berufsschulen. Bildung aber beinhaltet sowohl Denken als auch Handeln. In diesem Geist gilt es, den Kampf gegen Antisemitismus nicht nur auf Schulen und Lehrkräfte abzuwälzen, sondern zur allgemeinen Ratio zu erklären: gegen das eigene Halbwissen – für mehr (selbst-) kritische Bildung.
freiraum #66