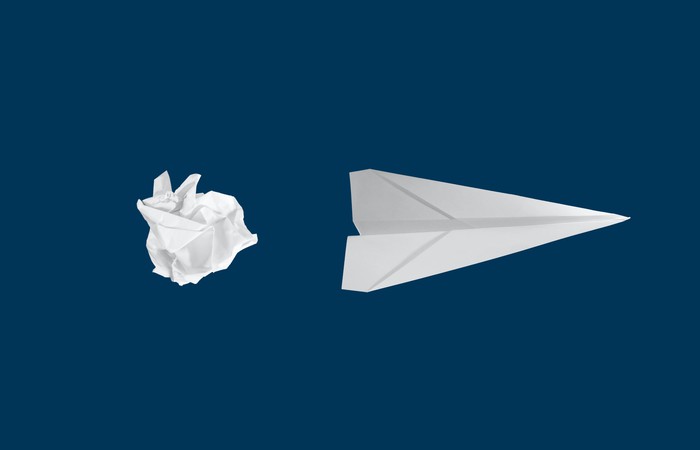Produktentwicklung, wo sie nicht erwartet wird. Von Tobias Ebbing
Forschung
Allein in den USA, Kanada und Großbritannien beschäftigen sich über 20 Millionen Privatpersonen, zwischen 5,2 – 6,7 Prozent der volljährigen Bevölkerung, in ihrer Freizeit damit, neue Produkte zu entwickeln oder bereits existierende zu verbessern. Diese Produktentwicklung, die vom Haushaltssektor statt von Firmen ausgeht, nennt sich Consumer oder User Innovation. Ergebnisse der Arbeit von User-InnovatorInnen sind beispielsweise Mountainbikes, Skateboards oder die Computerspielreihe DotA.
Durchschnittlich investieren User-InnovatorInnen in Großbritannien 7,1 Tage ihrer jährlichen Freizeit in Produktentwicklungsaktivitäten. Auf den britischen Bevölkerungsschnitt gerechnet sind das rund 97.800 Personenjahre mit 210 Arbeitstagen. Viermal so viel, wie in britischen Produktentwicklungsabteilungen gearbeitet wird. Diese Zahlen berichtete 2012 ein Autorenteam um Eric von Hippel, dem Begründer des jungen Forschungszweiges der „User Innovation“, in der Fachzeitschrift Management Science.
Das Ausmaß von User Innovation ist deshalb so erstaunlich, weil klassische Wirtschaftsmodelle Innovationsaktivität des Haushaltssektors nicht einplanen. Spätestens seit der Schumpeterschen Innovationslehre von 1934 gilt Produktentwicklung als Firmendomäne. Damit Firmen Fortschritt und Wirtschaftswachstum laufend mit Produktentwicklungsprojekten antreiben, wurden zahlreiche Anreizsysteme wie Patentrechte und Förderprogramme geschaffen. Haushalte erfüllten in der klassischen Wirtschaftslehre dagegen eine reine Konsumfunktion.
Die Verbesserung eines Produktes, Prozesses oder einer Dienstleistung, so die langjährige Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), ist nur dann eine Innovation, wenn sie vermarktet wird. Innovierende KonsumentInnen, von denen über 60 Prozent angeben, dass ihre Lösung auch für andere nützlich wäre, verfolgen jedoch kein vorwiegend kommerzielles Interesse. Entsprechend berichten nur sechs Prozent der von de Jong et al. (2015) befragten NutzerinnovatorInnen davon, ihre Produktentwicklungsergebnisse kommerziell zu verbreiten. User Innovation war damit bis vor Kurzem per Definition „unter dem Radar“.
2018 passte die OECD diese Definition zur Messung von Innovation an. Fortan gilt jede neue oder signifikant verbesserte Version eines Produktes oder Prozesses als Innovation, wenn sie potentiellen NutzerInnen zugänglich gemacht wurde. Damit gelten nun beispielsweise auch frei verfügbare Open Source Softwarelösungen, leistungssteigernde Verbesserungen an eigener Sportausrüstung und 3D-druckbare Modelle von medizinischen Prothesen als Innovation.
Betrachtet man dieses Phänomen unter Maximen der individuellen Nutzenmaximierung, verbleibt die Frage, weshalb KonsumentInnen hier systematisch eine traditionelle Aufgabe der ProduzentInnen auf eigene Kosten übernehmen.
Antworten lassen sich in der Verhaltensökonomik, aber auch in klassischen Modellannahmen finden. Grundsätzlich wird von Firmen erwartet, dass sie Bedarfe potentieller KundInnen schaffen oder erkennen und mit entsprechenden Angeboten daraus Erträge generieren.
Würden Firmen die Interessen aller NachfragerInnen lückenlos erfassen und befriedigen, sollten die ungedeckten Bedarfe, auf die User InnovatorInnen reagieren, nicht existieren. Da Innovationsarbeit jedoch Aufwand verursacht, braucht es zur Entwicklung eines neuartigen Produktes durch Firmen auch voraussichtliche wirtschaftliche Rentabilität.
Selbst wenn Firmen besonders ausgefallene Bedarfe, wie in den 60er Jahren auf Schnee zu surfen („Snurfer“, später Snowboards) oder auf Asphalt Schlittschuh zu laufen (später Inlineskates) erkannt haben sollten, so erschien die Produktentwicklung aufgrund geringer Nachfrage ursprünglich wohl kaum rentabel. Um ihre besonders individuellen oder fortschrittlichen Interessen abzudecken, sind NutzerInnen weiterhin auf ihre eigene Innovationskraft angewiesen. Oft zeigt sich langfristig, dass einst sehr speziell erscheinende Anforderungen gebräuchlicher sind oder werden als erwartet. In diesem Fall können auch Firmen solche Produkte rentabel vermarkten und einer breiteren Masse zugänglich machen.
Die Schwelle zur Rentabilität von Innovationsprojekten liegt bei KonsumentInnen aus verschiedenen Gründen vergleichsweise niedrig. Bereits die Akquise der „sticky“ Information über KundInnenbedarfe durch Marktanalyse ist für Firmen kostspielig.
User InnovatorInnen hingegen sind, entsprechend des Namens, meist NutzerInnen ihrer Innovation. Ihre Produkte lösen oft persönliche Probleme. Damit verfügen sie unmittelbar über die nötigen Bedarfsinformationen. Der Mukoviszidosepatient Louis Plante erlebte selbst, dass Physiotherapie unangenehm ist und tiefe Bassfrequenzen Schleim angenehmer in seiner Lunge lösten. Zur Umsetzung nutzen NutzerinnovatorInnen intuitiv Kenntnisse und Mittel, über die sie bereits verfügen, oder die sie sich leicht aneignen können. Als Musiker und Elektroingenieur war Louis Plante besonders befähigt, seinen Bedarf auch in eine Innovation umzusetzen.
Anders als Firmen ziehen User InnovatorInnen auch nicht-geldwerte Vorteile aus der Produktentwicklung. Neben dem eigenen Nutzeninteresse berichten sie von Spaß, Erfolgserlebnissen und Freude am Lernen. Probleme für andere Personen zu lösen, bietet unter anderem altruistische Gratifikation und Kompetenzgefühle. Auch gesellschaftlich bringt Innovationsarbeit häufig soziale Anerkennung mit sich. Kommerzialisierungstätigkeiten hingegen bieten solche Anreize für viele nicht in ausreichendem Maße.
Werden aus Lösungen doch kommerzielle Angebote, spricht man von „accidental“, also nebensächlichem oder unbeabsichtigtem Entrepreneurship. Anders als im klassischen Entrepreneurship-Prozess, der mit der Identifikation und Evaluation einer unternehmerischen Gelegenheit beginnt, steht hier zu Beginn die Lösung eines Problems ohne Rentabilitätsabwägung. Oft schlagen Freunde und Familienmitglieder InnovatorInnen später vor, die Lösung zu vermarkten. Dieser abweichende Hintergrund führt auch zu unterschiedlichem Vermarktungsverhalten.
Ich konnte beispielsweise anhand von 2.121 Produktvergleichen und 29 Interviews mit NutzerinnovatorInnen zeigen, dass deren Preissetzungsverhalten systematisch von dem von Firmen abweicht. Unter anderem, weil sie sich im Prozess bereits anderweitig belohnt sehen, setzen sie vergleichsweise geringere Preise als Firmen für gleichwertige Produktangebote. Die besondere Motivationslage der User-InnovatorInnen internalisiert sich also im Produktpreis.
Eine stärkere Wahrnehmung und Förderung der NutzerinnovatorInnen wäre damit nicht nur dem Fortschritt, sondern auch der Gesamtwohlfahrt zuträglich. Auch von Marktplätzen zum Austausch von User Innovation (z.B. Etsy, GitLab, itch.io) und einer stärkeren Einbindung in Firmen (z.B. LEGO Ideas, dem STEAM Workshop oder P&G connect + develop) können wir letztlich als Gesellschaft profitieren.
- Forschungsfeld: Vermarktung von User Innovation
- Universität: Technische Universität Hamburg
freiraum #67