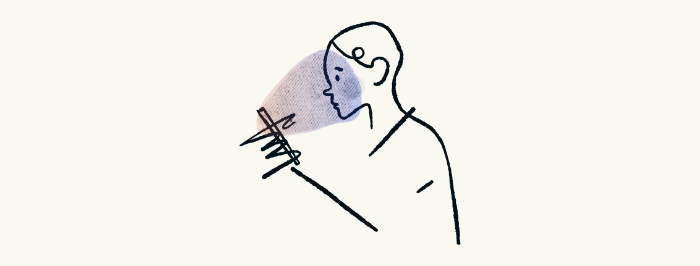Das völkerrechtliche Gewaltverbot und der Aufstieg Chinas. Von Andreas Lehrfeld
Forschung
Das Recht zum Krieg (ius ad bellum), sprich die Frage nach der Legitimität staatlicher Gewaltanwendung, ist ein höchst umstrittener Völkerrechtsbereich, in dem nationale Interessen und rechtliche Normen sich oft diametral gegenüberstehen. Daher bleibt die Annahme des amerikanischen Völkerrechtlers Thomas M. Franck (1931 – 2009) gültig: „Solange es Nationen gibt - was wahrscheinlich noch sehr lange der Fall sein wird - werden sie ihre nationalen Interessen verfolgen; und wo diese Interessen festgelegten internationalen Rechtsnormen zuwiderlaufen, werden sich letztere verbiegen und brechen.“ Ungeachtet dieses Konflikts hat sich das Gewaltverbot in seiner bestehenden Form gemäß Artikel 2 (4) der UN-Charta als völkerrechtlich bindend durchgesetzt. Mit seinen beiden Ausnahmen, dem Recht auf Selbstverteidigung (Artikel 51 der UN-Charta) und der Autorisierung von Gewalt durch den UN-Sicherheitsrat (Kapitel VII der UN-Charta) bildet es den Nukleus dieses Rechtsbereichs.
Dies ist der Ausgangspunkt meiner Forschung, die auch Veränderungen in der Struktur und Natur der internationalen Rechtsordnung berücksichtigt. Jüngere Studien wie etwa des US-amerikanischen Rechtswissenschaftlers Tom Ginsburg (2020) diskutieren die Entstehung eines „autoritären“ Völkerrechts, das mittels rechtlicher Praktiken und Normen das Überleben autoritärer Systeme sichern helfen soll. Dieser Trend zu einem autoritär gefärbten Völkerrecht ist besonders im Cyberspace zu beobachten. Nicht zuletzt auch in Form der von Russland und China 2001 begründeten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die sich regionalen Sicherheits-, Energie- und Handelsfragen in Zentralasien widmet, manifestiert sich dieses autoritäre Völkerrecht.
Ein weiteres Charakteristikum ist die fortdauernde Krise des Systems kollektiver Sicherheit im Rahmen der Vereinten Nationen. Unilaterale Interventionen ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates, etwa im Kosovo (1999) und im Irak (2003), haben dem System der kollektiven Sicherheit geschadet. Die zunehmende Komplexität bewaffneter Konflikte bedroht die internationale Sicherheit und wirkt sich auch auf den Charakter von UN-Friedensmissionen aus, die seit zwei Jahrzehnten regelmäßig mit einem „robusten“ Mandat eingesetzt werden, das die Anwendung von Gewalt über die reine Selbstverteidigung hinaus erlaubt. Die Terroranschläge des 11. September 2001 hatten ebenfalls weitreichende Folgen für das ius ad bellum, das ursprünglich nur die Gewaltanwendung zwischen souveränen Staaten regelte. In den Resolutionen 1368 (2001) und 1373 (2001) des UN-Sicherheitsrats stellte dieser jedoch fest, dass das Recht auf Selbstverteidigung auch bei Angriffen nichtstaatlicher Akteure greift, sofern Charakter und Umfang des Angriffs einem klassischen bewaffneten Angriff gleichwertig sind.
Zuletzt gewinnt auch der Cyberspace an Bedeutung, der völkerrechtlich noch kaum Regelungen unterworfen ist und auch für militärische Zwecke verwendet werden kann. So nimmt die Zahl der Cyberangriffe, die Infrastruktur beschädigen und damit auch potenziell Menschenleben gefährden können, zu. Ein Horrorszenario in diesem Kontext stellt etwa ein Angriff auf die Infrastruktur eines Wasserkraftwerks dar, in dessen Folge es zu weitreichenden Überschwemmungen und Zerstörungen kommen kann. Diese Liste an komplexen Herausforderungen für die internationale Rechtsordnung ist nicht abschließend, veranschaulicht aber gut, welche Einflussfaktoren auf das moderne Völkerrecht einwirken.
Parallel zu diesen Entwicklungen vollzieht sich der Aufstieg Chinas zur Großmacht. Unter Präsident Xi Jinping strebt das Land nicht weniger als die „Wiederauferstehung der chinesischen Nation“ (Zhonghua minzu fuxing) an, was sich durch ein erhöhtes Selbstbewusstsein und eine zunehmend aggressive Außenpolitik äußert. Chinas Geopolitik im Südchinesischen Meer und die aggressive Rhetorik gegenüber Taiwan spiegeln diesen Wandel wider. Darüber hinaus ist die Anwendung des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong (2020), das die völkerrechtlich verbriefte Autonomie der Stadt untergräbt, ein bemerkenswertes Zeichen dafür, dass die Volksrepublik China entschlossen sein kann, internationale Verträge zu missachten, wenn dies den nationalen Interessen zugute kommt.
Darüber hinaus strebt China aktiv eine Veränderung der globalen Ordnung zu seinen Gunsten an. So hat die Beteiligung an UN-Friedensmissionen in Afrika erheblich zugenommen, was dazu beiträgt, Chinas Selbstbild als „verantwortungsvolle Großmacht“ zu stärken. Die chinesische Führung bekräftigt ihre Ambitionen, die globale Ordnung zu ändern und hierzu ihre Beziehungen zu Staaten im globalen Süden zu intensivieren. Unter Xi Jinping hat etwa der Begriff „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ (renlei mingyun gongtongti) Eingang in offizielle Reden und Dokumente wie dem Weißbuch zur nationalen Verteidigung (2019) gefunden, mit dem die Solidarität mit dem globalen Süden ausgedrückt werden soll.
Die chinesische Rechtswissenschaft übt größtenteils Kritik an der internationalen Rechtsordnung. Cai Congyan von der Universität Xiamen fasst diese Kritik gut zusammen: „Das Völkerrecht ist vom Wesen her westlich. […] Es ist ein Produkt westlicher Zivilisation und geprägt von Eurozentrismus, christlicher Ideologie und Werten des ‚freien Marktes‘“. Laut Cai diente das Völkerrecht historisch oft als Instrument westlicher Staaten, um nichtwestliche Staaten und Gebiete zu erobern. In diesem Sinne dient das Völkerrecht als Mittel zur Unterdrückung der nichtwestlichen Welt. Die Tatsache, dass alle ehemals kolonisierten Staaten nicht aktiv an der Gestaltung der Grundlagen der gegenwärtigen internationalen Rechtsordnung beteiligt waren, zeige eine strukturelle Inkonsistenz im internationalen System auf. Oder, wie die chinesische Diplomatin Xue Hanqin argumentiert: das moderne Völkerrecht spiegelt die Grundwerte des westlichen Liberalismus wider.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass China, das im 19. Jahrhundert im Zuge des Ersten Opiumkrieges (1839 – 1842) ein „Jahrhundert der Demütigung“ (bainian guochi) mit Einschränkungen der eigenen Souveränität erlebte, das ius ad bellum restriktiv interpretiert. So wird antizipatorischer Selbstverteidigung wie im Falle des Irak eine Absage erteilt und der völkerrechtliche Gewaltbegriff eng auf rein militärische Gewalt hin definiert. Das Konzept der internationalen Schutzverantwortung (responsibility to protect, R2P), das 2011 in Libyen erstmals als Grundlage für eine Intervention herangezogen wurde, wird in der chinesischen Forschung mittlerweile skeptisch betrachtet, ebenso die breit ausgelegten UN-mandatierten Friedensmissionen. Zugleich versucht China auch aktiv, internationale Rechtsnormen zu setzen, etwa durch das Konzept der „Cyber-Souveränität“, das darauf abzielt, dass jeder Staat eigene Regeln für das Internet festsetzen kann. Es wäre zu kurz gegriffen, China ausschließlich als Bedrohung für die internationale Ordnung zu bezeichnen; jedoch sind klare Tendenzen Chinas erkennbar, das Völkerrecht im eigenen Sinne zu prägen.
- Name: Andreas Lehrfeld, M.A.
- Fachbereich: Moderne Chinastudien
- Lehrstuhl für chinesische Rechtskultur
- Universität zu Köln
Der Autor war von Oktober 2017 bis September 2020 als Westerwelle-Stipendiat in der Promotionsförderung der FNF. Er ist Programmreferent der FNF und befasst sich in seiner Dissertation mit „Chinese Positions on the Use of Force by States“.
freiraum #70