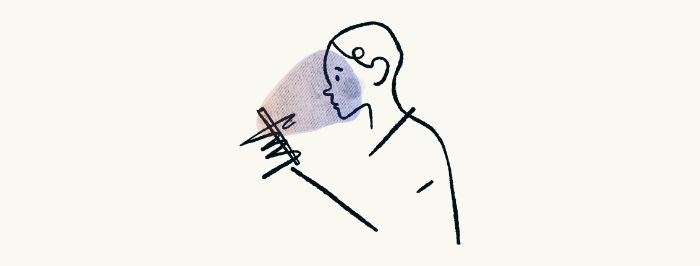Im zweiten Teil der Freiraum-Reihe "Zukunftsforum Freiheit" spricht sich unser Vorstandsmitglied Alice Katherine Schmidt dafür aus, auch in der Politik Irrtümer nicht mehr als Schwäche, sondern als Methode zu verstehen und stellt Ideen für eine Fehlerkultur-Offensive in der FDP vor.
Auf dem letzten VSA-Konvent „Fail Forward - Scheitern als Schritt zum Erfolg“ haben wir Fehler zelebriert, öffentlich gemacht und damit den Weg für Verbesserung geebnet. Bei der Einladung von FDP-Politiker:innen bekamen wir Absage um Absage: Über eigene Fehler will oder kann man als FDP-Politiker:in auch in einem freundlich gesinnten liberalen Kreis nicht sprechen. Dabei wird in der Wirtschaft das Scheitern gefeiert. Start-ups, die mutig scheitern, gelten als Vorbilder einer innovationsfreudigen Gesellschaft. In der Wissenschaft ist der Irrtum das Fundament des Erkenntnisfortschritts.
In der FDP hat sich in den letzten Jahren eine gegenteilige Kultur eingeschlichen: Wer Fehler zugibt, gilt als schwach. Wer umsteuert, als inkonsequent. Christian Lindner wandelte sich vom glühenden Verfechter eines offenen Umgangs mit Fehlversuchen am Beispiel des eigenen gescheiterten Start Ups im Landtag in NRW zum ewigen Rechthaber. Nicht einmal nach dem „Pyramiden-Fiasko“ oder dem misslungenen Rekurs auf Elon Musk – einem erklärten AfD-Sympathisanten – war ein ernst gemeintes Eingeständnis der eigenen Fehleinschätzung vernehmbar. Diese Kultur hat sich mit der Zeit über alle Gremien und Positionen hinweg innerhalb der FDP eabliert. So wurde in den letzten Jahren jeder noch so eindeutige Ausrutscher liberaler Verantwortungsträger:innen nicht öffentlich aus den eigenen Kreisen kritisiert. Selbst nach dem Rauswurf aus dem Bundestag und der anmaßenden Schlagzeile von Wolfgang Kubicki, dass sein größtes Problem nun der fehlende Fahrer sei, wurde dies in der Partei kaum kritisiert.
Dies mag vielleicht 2013, als die Partei nach außen massiv zerstritten und gespalten sowie führerlos wirkte, zeitweise ein sinnvolles Credo gewesen sein. Mittlerweile hat dieses Credo zu einer eindimensional denkenden Ein-Mann-Partei geführt, die bis zum bitteren Ende als einzige an die eigene Inszenierung des Rechthabens glaubt – mit dem Preis einer Entfremdung von liberalen Grundgedanken und damit sich selbst.
Karl Popper: Irrtum als Fortschrittsmotor
Dabei ist eine ausgeprägte und lebendige Fehlerkultur fester Bestandteil der liberalen DNA. Dies beschrieb der vermutlich prägendste und liberal gesinnte Philosoph der Wissenschaftstheorie Karl Popper. Die Grundannahme: Alle Ideen, Gedanken und Theorien der Menschen sind fehlbar. Durch die „Methode des Versuchs und der Ausmerzung von Irrtümern“ könne sich der Mensch im Sinne eines kritischen Rationalismus der Wahrheit zu nähern. Dies beschrieb er etwa in seinem Werk Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf (1984).
In seinem Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1945) überträgt Popper dies auf die politische Bühne. Popper betrachtete nicht die Durchsetzungskraft, sondern die Korrigierbarkeit von Macht als das entscheidende Merkmal einer freien Gesellschaft und spricht dabei in der Umsetzung von einer „Sozialtechnik“. Die Rahmenbedingung hierfür seien eine „offene Gesellschaft“, die den Diskurs nicht nur zulässt, sondern aktiv Plattformen für den Austausch zu Hypothesen, Fehlern und die Annäherung an eine bessere Politik ermöglicht.
Übertragen auf die FDP bedeutet dies, dass in den letzten Jahren durch die Negierung von Fehlern und einer Kultur der ausbleibenden Kritik innerhalb der Partei das eigene Denken immer weiter eingeschränkt und verengt wurde. Eine Annäherung an eine moderne und zeitgemäße Interpretation des Liberalismus wurde nicht möglich. In den Vordergrund trat stattdessen mit der festen Überzeugung des Rechthabens ausgestattet die immer fortwährende Kritik an anderen Parteien. Am liebsten mit einem Fokus auf die Grünen, die im deutschen Parteienspektrum vermutlich noch am nächsten an einer konstruktiven Fehlerkultur liegen.
Der Blick nach vorn: Eine Fehlerkultur-Offensive für die FDP
Doch was nicht ist, kann noch werden. Die Grundlage hierfür kann eine bewusste Entscheidung hin zu einer Fehlerkultur-Offensive mit Fokus auf stetige und konstruktive Verbesserungen bilden. Diese Initiative kann durch die unten benannten Maßnahmen unterstützt werden. Am Ende entscheiden über die erfolgreiche Umsetzung vor allem die Parteimitglieder und Verantwortungsträger:innen, die diese neue Kultur in ihren Alltag übersetzen müssen.
Irrtum ist keine Schwäche, sondern Methode: Ideen für die Fehlerkultur-Offensive in der FDP
- Externe Reflexionsallianzen statt interner Betriebsblindheit: Die FDP besteht derzeit darauf, parteistrukturelle Herausforderungen selbst zu lösen. Am Beispiel des seit Jahrzehnten bestehenden geringen Frauenanteils zeigt sich, dass dies scheitert. Die Partei sollte stattdessen gezielt Reflexionsallianzen mit externen Akteur:innen, wie Organisationsforscher:innen, Expert:innen, Gründer:innen, Think Tanks oder Community-Initiativen eingehen. Diese können blinde Flecken benennen, Routinen aufbrechen und konkrete, evidenzbasierte Veränderungsprozesse anstoßen.
- Retrospektiven als Rückblick und Lernpotenzial in Parteivorständen: Im Projektmanagement weiß man es schon lange: Der Erfolg der Teamzusammenarbeit wird maßgeblich von der Stimmung in Teams beeinflusst und Retrospektiven sind in agilen Unternehmen ein Instrument, um diese stets zu verbessern. Auch Parteivorstände sollten verpflichtende Retrospektiven durchführen. Damit sind alle sechs Monate stattfindende strukturierte Rückblicke zur Selbstreflexion gemeint. In moderierten Sitzungen werden folgende Fragen behandelt: Was lief gut? Was lief schief? Was haben wir gelernt? Was ändern wir konkret? Die gemeinsam beschlossenen Änderungen werden mit Verantwortlichkeiten und Fristen versehen und bei der nächsten Retrospektive hinsichtlich der Umsetzung geprüft.
- Ein Ombudsteam mit echten Befugnissen: Die Jungen Liberalen leben bereits vor, dass ein Team die Ombudstätigkeit besser und vermutlich mutiger umsetzen kann, als eine Einzelperson. Die FDP braucht auf allen Ebenen institutionalisierte Ombudsteams, die gesellschaftliche Vielfalt abbilden und intern echte Widerspruchsräume mit Wirkungskraft eröffnen. Die Befugnisse sollten künftig nicht darin enden, auf einem hektischen Bundesparteitag in wenigen Minuten einige kritische Anmerkungen zu machen. Ombudsberichte sollten allen einsehbar sein und Vorstände sollten innerhalb einer Frist darauf schriftlich und anhand einer Maßnahmenliste reagieren müssen. Zudem sollte die Zugänglichkeit für das Ombudsteam zum Präsidiumssitzungen und zu Informationen aus Strategiepapieren selbstverständlich sein.
Fazit: Irrtum als Tugend des Liberalismus
Das misslungene Bundestagswahlergebnis der FDP birgt die Chance, zur Partei der offenen Fehlerkultur mit neuen und im Parteienspektrum einzigartigen Standards zu werden. Denn Freiheit heißt auch: Den Mut zu haben, falsch zu liegen und es besser zu machen.
Mehr aus dieser Reihe
Ein Vorwort zum “Nachwort”: Über die schöpferische Kraft der konzeptuellen Beerdigung (Sven Gerst)
Zeit für Vertrauen – Warum eine liberale Partei Open Primaries wagen sollte (Henri Kirner)