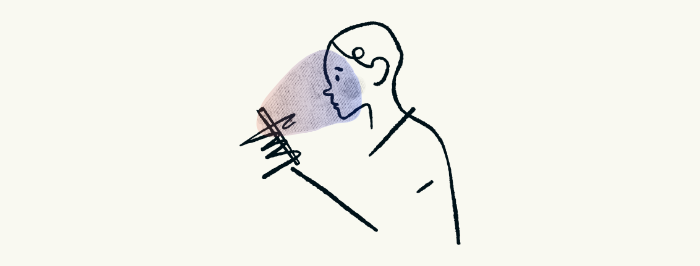Constantin Eckner im Gespräch mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner über die Ziele seiner Partei, das Schicksal des Liberalismus in Deutschland, die Debattenkultur in der Republik sowie die weiterhin schwelende Migrations- und Integrationsfrage.
Interview
freiraum: Ich möchte mit einem tagesaktuellen Thema beginnen. Sie haben sich sehr explizit zur Wiedereinführung der Wehrpflicht beziehungsweise Dienstpflicht, wie es die CDU nun nennt, geäußert. Die Reaktionen auf Ihre Tweets, aber auch Umfragen zeigen, dass viele das für eine gute Idee halten. Diese 18-, 19-Jährigen sollen etwas fürs Leben lernen, heißt es. Sind Sie als Liberaler manchmal erstaunt darüber, wie groß der Hang zu Volkserziehung, dieser Glaube, dass der Staat alles jedem beibringen muss, ist?
Lindner: Nein, leider überrascht mich das nicht. Liberalität ist ein Zustand, der immer wieder neu behauptet und verteidigt werden muss. In Deutschland gibt es vielleicht bereits seit dem Dreißigjährigen Krieg und den Zeiten Hegels eine Art von Überhöhung von Staatlichkeit, die oft genug den Individualismus infrage stellt. Wir sind vielleicht das einzige Volk auf der Welt, das lieber Geld beim Staat abgibt, als selbst darüber zu verfügen. Und vielleicht das einzige Land, in dem Familien nicht selbst Verantwortung für ihre Kinder übernehmen wollen, sondern sich lieber den Staat als Erzieher wünschen. Das ist die gesellschaftspolitische Grundierung einer an sich auch fachlich unsinnigen Debatte.
Und glauben Sie, dass es Liberalismus als politische Ordnungslehre oder als politische Philosophie deshalb auch besonders schwer hat in Deutschland, weil eine derart große Staatsfreundlichkeit vorherrscht?
Ja! Die FDP ist in Deutschland ein Angebot für besonders mutige Persönlichkeiten, die den Gedanken an die Selbstverantwortung pflegen, Freude an den Ergebnissen ihrer eigenen Schaffenskraft haben und im Zusammenleben mit anderen geleitet sind von Großzügigkeit und Toleranz. Wer ein Menschenbild hat, dass andere schwach und anleitungsbedürftig sind, der wird immer auf den Staat als Erzieher setzen. Wer glaubt, dass Menschen böse und verführbar sind, der wird immer einen Staat wollen, der uns mit vielen Gesetzen, Kameras und der Durchleuchtung des Privaten voreinander schützt. Wir haben das optimistischste, freundlichste Menschenbild und deshalb wollen wir einen Staat als Partner, als Schiedsrichter, aber nicht als Vormund und Kontrolleur.
In Ihrem Buch „Schattenjahre“ gehen Sie darauf ein, wer eine zentrale Zielgruppe der FDP sein soll. Weniger die Besitzstandswahrer, was man Ihnen gerne unterstellt, sondern vor allem die Nonkonformisten und Aufstiegswilligen, die Start-Up- Gründer und Risk-Taker. Fühlt sich die FDP denn in gewisser Weise wohl in dieser Rolle des Außenseiters – als Stimme der Außenseiter?
Die FDP hat nur eine Zielgruppe: Das sind Menschen, die unser Lebensgefühl teilen, egal welcher Beruf, welches Geschlecht, welches Alter oder welche Herkunft. Wer gerne seinem Leben eine Richtung gibt und anderen das auch zubilligt, der ist bei uns willkommen. Wenn man diese Form von wohlverstandenem, freundlichem Individualismus leben will, dann sind Demokratie und Rechtsstaat und offene Gesellschaft und Marktwirtschaft die besten Ordnungen. Diese Form der Individualität oder des Individualismus ist sowohl Voraussetzung als auch Konsequenz einer vielfältigen, bunten Gesellschaft. Die schöne Pointe ist, dass eine Gesellschaft, die besonders vielfältig ist, in der also nach den Worten von Richard Florida Technologie auf Talent und Toleranz trifft, auch eine besonders progressive, fortschrittliche und flexible Gesellschaft ist, von der alle profitieren. Ja, aber das möchte ich sagen: Es ist so, weil Innovation immer von den Rändern kommt. Die Etablierten neigen dazu, satt zu werden oder ihre Macht zulasten der Newcomer auszuspielen. Dabei sind es doch die Newcomer, die Risikobereiten, die Exzentriker, die Außenseiter, die Zugereisten, die oft genug das System stören und es deshalb auch zu neuen Antworten zwingen.
Über Sie selbst als politische Führungsfigur und Ihre Art der Kommunikation herrschen geteilte Meinungen. Manche werfen Ihnen vor, Sie seien der eitle Elitäre, der oft ins Intellektuelle flüchtet. Andererseits habe ich Sie auch schon bei Reden erlebt, bei denen Sie klare Botschaften haben und fast schon volkstümlich vermitteln wollen. Gibt es für Sie diese bewusst unterschiedlichen Wege der Kommunikation, je nachdem, wer das Publikum ist? Oder schlummert in Ihnen schlichtweg beides?
Es ist immer abhängig vom Thema. Es gibt Themen, die kann man klar zuspitzen. Und es gibt Themen, die verlangen geradezu nach der Differenziertheit. Ich bin übrigens kein großer Freund der klaren Zu- spitzung, sondern ich bin ein Anhänger des Prinzips »sowohl-als-auch« oder »einerseits-andererseits«. Eigentlich wird das gerne zum Vorwurf gemacht, wenn man »sowohl als auch« oder »einerseits an- dererseits« sagt. Ich glaube aber, dass viele Fragen gar nicht anders zu beantworten sind.
Zum Beispiel muss man sagen, dass einerseits Menschen mit anderer ethnischer oder kultureller oder religiöser Herkunft in diesem angeblich so offenen und toleranten Land immer noch Erfahrungen mit Alltagsrassismus machen. Wir sind noch nicht wirklich die vielfältige, offene Gesellschaft. Andererseits müssen wir sehen, dass es in der Migrantencommunity auch Menschen gibt, die sich auf unsere Toleranz berufen, aber unsere westlichen Werte in ihrem eigenen Leben gar nicht verkörpert sehen wollen. Auch denen muss man sagen, dass unsere Erwartung an Integration zunächst eine Anforderung und eine Frage der Verantwortung und nicht nur eine Frage von Recht und Inanspruchnahme ist.
Sie sprechen ein interessantes Thema an. Was Sie gerade andeuteten, haben Sie schon mehrfach öffentlich kundgetan. Zum Beispiel als es um die Integrationswilligkeit von türkischstämmigen Mitbürgern ging. Sie hatten in diesem Jahr auch schon Schlagzeilen mit der Anekdote des Besuchs beim Bäcker gemacht. Insgesamt hat sich die FDP in der jüngeren Vergangenheit stärker zum Thema Immigration positioniert. War das eine bewusste Richtungsentscheidung, dass man gewisse Zielgruppen ansprechen möchte, die eben nicht links stehen, sondern eher weiter rechts?
Die Unterstellung, die in Ihrer Frage enthalten ist, will ich außerordentlich zurückweisen. Eine weltoffene, liberale Einwanderungspolitik ist nicht links oder rechts, sondern sie ist vernünftig. Und sie umfasst die Offenheit der Gesellschaft für Multikulturalität und Multireligiösität. Wir sehen Deutschland nicht als Volksgemeinschaft und auch nicht als Teil einer christlichen Leitkultur, wie Parteien rechts der Mitte das tun. Aber wir teilen auch nicht die Naivität von links, dass man nicht auch entschieden liberale Werte verteidigen muss. Ich verstehe die politische Linke nicht, die in den fünfziger und sechziger Jahren nicht scharf genug gegen die katholische Kirche auftreten konnte und auch religiöse Glaubensüberzeugungen aus der katholischen Lehrmeinung infrage gestellt hat, heute aber wachsweich ist, wenn es darum geht, auch zu beschreiben, dass es natürlich innerhalb eines Teils der islamischen Community eine Geringschätzung von Beteiligungsrechten von Frauen gibt oder autoritäre Herrschaftsbilder kultiviert werden. Warum gehen wir damit anders um, als mit dem Katholizismus der sechziger und siebziger Jahre? Das hat nichts mit links und rechts, sondern nur mit liberal und naiv zu tun.
Stört es Sie dann, wenn man solche Dinge anspricht, dass beispielsweise argumentiert wird, man nähere sich der AfD an? Stört Sie das in der politischen Kultur?
Es ist einfach nur eine Verharmlosung der AfD, wenn man liberale Positionen im gleichen Atemzug nennt. Eigentlich enthüllt das nur, dass ein Teil der Debatte so krass links-ideologisch und gesinnungsethisch geprägt ist, dass sie sich völlig von der praktischen Alltagsvernunft abgekoppelt hat. Ich gehe sogar weiter. Ich unterstelle ein bewusstes Missverstehen-Wollen, eine Bösgläubigkeit und oft genug ein Denken mit Scheuklappen. Sie haben ja Beispiele genannt. Wenn ich sage, in der türkischstämmigen Community gibt es eine Geringschätzung freiheitlicher Werte, dann wird einem Rassismus vorgeworfen. Die Fakten sagen, dass Herr Erdoğan in den deutschen Wahllokalen deutlich höhere Zustimmungswerte hatte als in İzmir, Ankara oder İstanbul. Und wenn man sagt »in der« türkisch- stämmigen Community, heißt das nicht alle Angehörigen, sondern »in der«.
Was ist falsch an meinem Bäcker-Beispiel? Es war ein schwuler Zuwanderer aus Asien, der mir berichtet hat, dass er seit dem Sommer 2015 beim Brötchenholen schief von den anderen in der Reihe angeschaut wird, weil als Antwort auf das Gefühl eines staatlichen Organisationsversagens die Menschen im Alltag Unsicherheit empfinden. Und dieser Migrant, um dessen Freiheit ich mich bemühe, fordert, dass es endlich wieder einen verlässlichen Rechtsstaat gibt, damit im Alltag die Menschen Handlungssicherheit haben.
Also werden Sie, obwohl es mit dem Bäcker-Beispiel medial eher nach hinten losging...
Das sehe ich gar nicht so.
Sie werden solche Beispiele weiterhin anführen?
Aber selbstverständlich! Auch dieses einzelne Beispiel. Dieses Beispiel ist im Grunde der beste Beleg für die völlig hysterische Debattenkultur, die wir in Deutschland aus Quoten- und Reichweitensüchtigkeit in den Onlinemedien haben – aufgrund einer Überreizung und einer völligen intellektuell schmalen neuronalen Bandbreite. Denn als ich dieses Bäcker-Beispiel, das ein Praxisbericht eines Migranten war, genannt habe, haben die 100 anwesenden Vertreter des kritischen Qualitätsjournalismus im Saal des Parteitags nicht berichtet und noch nicht einmal eine Rückfrage gestellt. Erst eine verdrehte Variante, die 30 Stunden später in Umlauf gebracht worden ist, hat bei den Journalisten, die nicht im Saal waren und die Rede nicht gehört haben, Reaktionen ausgelöst. Das zeigt für mich eins: Es ist weniger eine Aussage über die Position der FDP oder gar die Sachfrage, sondern es ist mehr eine Temperaturmessung unserer überhitzten Debattenkultur.
Sehen Sie in naher oder fernerer Zukunft eine qualitative Besserung? Oder glauben Sie, dass diese Hysterie weitergehen wird und dass es sich langfristig negativ auf die politische Debattenkultur auswirken könnte?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sich eine wachsend große Zahl von Menschen durch diese Art von Diskussion nicht mehr angesprochen fühlt. Ich beobachte in öffentlichen Debatten einen bisweilen völlig überreizten Ruck nach links, wo hinter jeder Ecke Rassismus gesehen wird und auf der anderen Seite an den Stammtischen einen Ruck nach rechts, wo auch völkische Ressentiments salonfähig werden. Und ich wende mich gegen beides. Ich lasse mich nicht einschüchtern von einer Shitstorm-Kultur linker Trolle in den sozialen Medien. Und auf der anderen Seite werde ich niemals schweigen, wenn hinter dem Mantel des »man wird doch noch sagen dürfen« in Wahrheit völkische Ressentiments verbreitet werden. Der Platz des Liberalen ist eben der zwischen allen Stühlen und man muss sich dort wohl fühlen.
Da wären wir wieder bei der These, dass die FDP eine gewisse Außenseiterrolle in der Mitte hat.
Ja, genau! Die FDP ist die Partei der radikalen Mitte, weil wir uns auf ein einerseits-andererseits festlegen in der Migrationsdebatte, weil wir an praktischer Alltagsvernunft unsere Dinge messen und weil wir uns vielleicht als Partei, in der klarsten Form von allen, zu der Verantwortungsethik eines Max Weber bekennen.
Eine letzte Frage zum Thema AfD. Einerseits gibt es klare Rassisten und Ausländerfeinde, die dort ein Zuhause gefunden haben. Andererseits sieht man auch, dass es gewisse Gruppen gibt, welche die AfD aktuell unterstützen, die sich nicht verstanden fühlen, die meinen, es gibt diese Eliten im fernen Berlin. Sind das am Ende nicht Bürger, die eigentlich keine radikale Agenda unterstützen?
Es mischt sich dort sehr viel. Ein nicht zu unterschätzender Teil der AfD sind Menschen, die schon immer ethnische oder kulturelle oder religiöse Ressentiments oder Überlegenheitsgefühle kultiviert haben, die in Abschottung denken und die möglicherweise keine Lehren aus der deutschen Geschichte gezogen haben. Eine weitere Gruppe von Menschen hat vielleicht das Gefühl einer gewissen Abgehängtheit, auch aufgrund ihrer sozialen Situation. Das sind insbesondere Menschen, die von politisch linken Parteien zur AfD gekommen sind. Ein Phänomen, das wir auch aus Frankreich beim früheren Front National kannten. Das bemerkenswerte Buch »Rückkehr nach Reimes« hat nachgezeichnet, wie die Eltern des Autors (Anm.: Didier Eribon) politisch von ganz links nach ganz rechts gewandert sind. Und es gibt eine dritte Gruppe. Dazu gehören die Ratsmitglieder der SPD aus Essen, die nicht über Nacht Nazis geworden sind, aber die aus der SPD ausgetreten und in die AfD eingetreten sind, weil sie mit der Einwanderungspolitik nicht zufrieden sein konnten, weil sie das Gefühl hatten, die Eliten in Berlin geben ihre Kinder in Privatschulen und fahren mit Dienstfahrzeugen und sie selbst erleben die Überforderung der Schule, die Knappheit des Wohnraums im Stadtteil, die teilweise Infragestellung der öffentlichen Ordnung im Zuge einer nicht kontrollierten Einwanderung. Sie glauben dann ihr Heil in der AfD zu sehen und erkennen nicht, dass man mit der AfD eben keine geordnete Einwanderungspolitik bekommt – eine solche müsste nämlich europäisch, weltoffen und individualistisch sein –, sondern dass man mit der AfD eine Abschottung und eine kulturelle Verarmung des Landes einkauft. Also alles das, was sie eigentlich als ehemalige Sozialdemokraten niemals wollen können.
Sind Sie manchmal davon genervt, dass dieses eine Themenfeld, Einwanderungs- und Asylpolitik, alles überstrahlt und andere Themen nicht mehr durchdringen?
Wir haben viele andere wichtige Themen. Ich denke an die Digitalisierung. Ich denke an das Bildungssystem, das vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss. 90 Prozent der öffentlichen Mittel setzen wir für Bildungspolitik bis zum Ende der Erstausbildung ein. Aber danach kommt noch das ganze Leben. Wir müssten danach einen höheren Anteil unserer Ausgaben platzieren. Dann nicht mehr im Wettbewerb von 16 Bundesländern untereinander, sondern mit stärkerer Mobilität und Vergleichbarkeit innerhalb Deutschlands. Die Frage der wirtschaftlichen Zukunft unseres Landes. Die Finanzierbarkeit des Sozialstaats, der Infrastruktur, unserer globalen Ordnung. Die Liste ließe sich fortsetzen. Viele wichtige Themen. Es beherrscht ein dringliches Thema die politische Szenerie. Geradezu mit der Wirkung einer Blendgranate. Nun sieht man nichts anderes mehr außer diesem Thema. Und deshalb muss es schnell am liebsten überparteilich gelöst werden, damit wir uns den übrigen wichtigen Themen zuwenden können.
Stichwort Digitalisierung, Stichwort Wirtschaftspolitik im Allgemeinen. Wie macht man denn eigentlich als Liberaler Wirtschaftspolitik? Vielleicht fordert man gerne als jemand, der in einem legislativen Gremium sitzt, dass der Staat dieses oder jenes tun sollte, während der klassische Liberale fragt, warum der Staat überhaupt etwas unternehmen muss. Ist es ein gewisser Drahtseilakt?
Das finde ich nicht. Ich zähle mich ja nicht zu den klassischen Liberalen, sondern ich zähle mich zu den Neoliberalen. Und als Neoliberaler weiß ich, dass der Staat als Schiedsrichter zur Durchsetzung von Regeln dringend benötigt wird. Das war gerade die Idee von Alexander Rüstow und anderen, die sich erstmals als »neue Liberale« verstanden haben. Im konkreten Fall begrüße ich, dass unsere Parteifreundin, die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, bei Google Kartellstrafen verhängt und bei Apple Steuerzahlungen einfordert. Denn unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung funktioniert nur dann und wird nur dann als fair und offen empfunden, wenn niemand so mächtig wird, dass er über die Eingangs-, die Markt- oder die Lebenschancen anderer selbstherrlich bestimmen kann. Und bei GAFA – also Google, Apple, Facebook und Amazon – besteht die Gefahr, dass sie sich irgendwann von einer aus demokratischen Prozessen ergebenen Governance entkoppeln. Wir möchten es dazu nicht kommen lassen. Auf der anderen Seite gibt es manche Alltagsbürokratie der Datenschutzgrundverordnung, die man eleganter ins deutsche Recht hätte übersetzen können, sodass nicht Europa als Ursache für Scherereien im Alltag gesehen wird, sondern als Beitrag zur Lösung großer Fragen.
In Bezug auf Digitalisierung und Automatisierung gibt es die Prognosen, wie viele Jobs eventuell überflüssig werden. Die Studie von Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne sei als eine von mehreren zu nennen. Von der politischen Linken kommt häufig der Vorschlag, dass bei höherer Produktivität und dem gleichzeitigen Wegfall von Arbeitsplätzen das bedingungslose Grundeinkommen eine Lösung wäre. Welche ganz zentralen Strategievorschläge hat denn die FDP, um der Digitalisierung entgegenzukommen, sie zu fördern und gleichzeitig auf die neue Arbeitsmarktsituation zu reagieren?
Ich stelle zunächst einmal ganz grundsätzlich diese Prognosen infrage. Solche Prognosen hat es regelmäßig bei industriellen Umbrüchen gegeben: bei der Einführung des Autos, als die Pferdefuhrwerke entfallen sind; bei der Einführung der E-Lok, als der Heizer, der Kohlen geschaufelt hat, entfallen ist; bei der Einführung der sogenannten elektronischen Datenverarbeitung, als man nicht mehr durchgehend mit Schreibmaschine und Steno arbeiten musste. Also ich stelle es grundsätzlich infrage und glaube, dass mehr Jobs entstehen könnten, die den großen Vorteil haben, dass sie nicht mehr monoton und sogar gesundheitlich, körperlich anstrengend sind, sondern im Gegenteil schöpferisch, kreativ und selbstbestimmt sein könnten. Uns wird die Arbeit bei Bildung, bei Gesundheit, bei Pflege und bei Infrastruktur nicht ausgehen. Da haben wir viel mehr zu tun. Da könnte ein großer Aufwuchs stattfinden.
Die Aufgabe ist nur, durch Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass aus Arbeit Jobs werden. Jenseits dessen lehne ich ein bedingungsloses Grundeinkommen ab, weil es eine Stilllegungsprämie für Menschen sein könnte. Ich möchte ein zweites Bildungssystem, das es jedem Menschen in jeder Phase des Lebens ermöglicht, etwas Neues zu lernen, damit keine Biografie eine Sackgasse wird, aus der man sich nicht mit Fleiß und gutem Willen selbst befreien kann. Es muss das soziale Versprechen der Gesellschaft sein, immer frische Startpunkte zu bieten, auch wenn man vielleicht schon über 50 ist, und nicht zu sagen, ab jetzt wirst du nicht mehr gebraucht. Denn Arbeit ist eben nicht nur Quelle von Einkommen, sondern auch von Sinn, Quelle vom Gefühl, gebraucht zu werden, von sozialer Teilhabe, von Struktur im Alltag.
Sehen Sie dann eine breite gesellschaftliche Angst vor Digitalisierung, vor dem, was eventuell kommt?
An vielen Stellen gibt es die. Sogar Größen des Silicon Valley wie Bill Gates sprechen von Maschinensteuer und bedingungslosem Grundeinkommen. Übersetzen wir das doch mal: Strafe für genutzten Produktivitätsfortschritt und Stilllegungsprämie für Menschen, die wir nicht neu qualifizieren wollen oder die sich selber nicht mehr der Lust hingeben wollen, den Horizont zu erweitern und nochmal etwas Anderes, etwas Neues zu lernen. Beides bremst menschlich-individuellen und gesellschaftlichen Fortschritt. Und deshalb empfehle ich uns, solchen Ideen nicht näher zu treten. Nebenbei gesagt: Wir sind in einer alternden Gesellschaft. Wenn viele der Jobs, die wir angesichts der Alterung der Gesellschaft in den nächsten Jahren nicht mehr werden besetzen können, durch Digitalisierung wegfallen, wäre das eine Hilfe, unser Wohlstandsniveau zu halten.
Machen wir einen kleinen Schwenk und kommen noch einmal auf die FDP zu sprechen. Sie haben damals am Wahlabend 2013 mit Wolfgang Kubicki geschworen, die Partei aus dem Schlamassel herauszuholen. Das hat funktioniert. Es hätte beinahe in einer Regierungsbeteiligung gemündet. Wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit, auf das, was sie in der außerparlamentarischen Opposition geschafft haben, was macht Sie persönlich am meisten stolz?
Wir haben einen sehr breit angelegten Leitbildprozess vorgenommen. In dessen Zentrum stand die Frage: Warum braucht es überhaupt eine liberale Partei in Deutschland? Im Zuge dessen haben wir uns von allem, was ängstlich, opportunistisch und klein im Denken war, gelöst. Wir haben den Freisinn wirklich als Lebensgefühl wiederentdeckt. Man könnte sagen: von Trümmerteilen befreit. Die FDP ist heute eine andere Partei als damals. Und ich sage, sie ist heute mehr denn je eine ganzheitlich liberale Partei. Eine Partei, die einen 360-Grad-Liberalismus vertritt. Alles in 360-Grad-Perspektive um das Individuum. Was es klein macht, bekämpfen wir. Und was es groß macht, fördern wir. Klein werden Menschen gemacht durch Bürokratismus, ökonomische Machtballung, Shitstorm. Groß werden Menschen gemacht durch Bildung, Flexibilität am Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Dynamik, Meinungsfreiheit, Toleranz und eine internationale große Ordnung, die Freiheit garantieren.
Glauben Sie, dass die FDP mittlerweile als ganzheitlich liberale Partei wahrgenommen wird? Es gab eine Zeit, da wurde sie vor allem als Wirtschaftspartei gesehen. Hat sich das Bild in der breiten Öffentlichkeit entscheidend verändert?
Das weiß ich nicht. Der Prozess ist auch noch gar nicht abgeschlossen. Zudem muss man sehen, dass ausweislich der letzten Wahl 89 Prozent die FDP nicht gewählt haben. Wir haben also noch ein großes Potenzial für Wachstum. Aber wir haben natürlich auch gegen viele Widerstände zu kämpfen. Die professionellen Unterstützer von CDU und CSU und SPD und Grünen und Linkspartei und AfD haben nicht unbedingt das Interesse, öffentlich zu konstatieren: Diese FDP ist neu und anders. Und die wollen nicht konstatieren, dass die FDP eine prinzipienfeste und ganzheitlich liberal aufstellte Kraft ist.
Gehört zur Prinzipienfestigkeit auch, dass man aus einer Koalitionsverhandlung aussteigt, und deutlich macht, dass man nicht der Steigbügelhalter ist?
Das gehört dazu. Genauso wie es dazugehört, wenn es möglich ist, Regierungsverantwortung anzustreben, wie wir das in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr auch getan haben. Wir hätten damals bei Jamaika, worauf Sie anspielen, schneller entscheiden müssen, nicht in die Regierung einzutreten. Nämlich als klar war, dass es nicht geht. Und ich persönlich werfe mir vor, zu vornehm und zu verhalten bei der Begründung gewesen zu sein. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich an dem Abend, als wir vor die Presse getreten sind, sagen: Mit dieser Kanzlerin im zwölften Jahr geht es nicht mehr, weil sie festgefahren ist. Und mit diesen Grünen geht es nicht mehr, denn sie sind links und wollen eine Republik, die wir nicht wollen. Nämlich eine Republik, in der der einzelne Mensch oft genug nur Objekt von politischer Gestaltung ist und nicht selbst Akteur oder Subjekt.
Selbst als Vollprofi und Vollblutpolitiker wacht man manchmal nachts auf, spielt so ein Szenario durch, was man durchlebt hat, und ärgert sich, dass man nicht die richtigen Worte fand?
Natürlich denkt man daran und deshalb sehe ich auch mit wachsendem Abstand zwei Fehler: Die Entscheidung rauszugehen war goldrichtig. Das hat sich noch einmal bestätigt durch die Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU. Der Zeitpunkt war zu spät. Das habe ich schon sehr früh danach gesagt. Schon im Dezember des letzten Jahres. Heute, noch einmal ein halbes Jahr, später weiß ich, wir waren viel zu soft, viel zu zurückhaltend, viel zu vornehm, viel zu defensiv in der Begründung. Viel offensiver hätte man es persönlich an die Kanzlerin adressieren müssen. Da war der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck klarer als ich. Man hätte viel deutlicher sagen müssen, mit den Grünen, einer linken Kraft, die Gleichheit möchte und Menschen erziehen will, kann eine liberale Kraft, die Freiheit fördern und Menschen befreien will, eben gegenwärtig nicht zusammenarbeiten.
Ihre selbstkritische Art ist für einen Spitzenpolitiker eher untypisch. Das hat Ihnen schon viele Sympathien eingebracht. Andererseits sagen jene, die die FDP kritisch sehen, dass die Partei eine One-Man-Show ist. Was würde mit der FDP geschehen, sollte Christian Lindner morgen aus der Politik aussteigen und sich ganz seinem Hobby der Wildjagd widmet?
Dann würde der Platz sofort gefüllt. Denn Medien konzentrieren sich auf die jeweilige Nummer eins einer Partei, auch wenn das gar nicht meine Absicht ist.
Und eine abschließende Frage: Inwieweit werden Think Tanks, die Stichwortgeber und Analysten, die im Hintergrund arbeiten, in Berlin an Bedeutung gewinnen? Was können Institutionen wie die Friedrich-Naumann-Stiftung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für eine Partei aber auch insgesamt leisten?
Sie gewinnen an Bedeutung, weil sie vernetzter und entfernt vom politischen Tagesgeschäft denken können. Sie haben aber mit der Förderung von Stipendiaten daneben eine wichtige Aufgabe im Generationenverbund. Nicht zuletzt sehe ich die internationale Arbeit als wichtig an. Gerade vor dem Hintergrund einer völlig infrage gestellten Weltordnung und einem Aufstieg des Autoritarismus in vielen Systemen, in vielen Gesellschaften, kommt der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit und gerade dem Eintreten für liberale Werte eine besondere Bedeutung zu. Und das nicht nur in den Schwellen- und Entwicklungsländern, sondern sogar in angeblich oder früher gefestigten Demokratien wie den Vereinigten Staaten. ■
Zur Person
Christian Lindner (39) ist seit 2013 Bundesvorsitzender der FDP und war zuvor von 2009 bis 2011 Generalsekretär der Partei. Dem Deutschen Bundestag gehörte er erstmals zwischen 2009 und 2012 und erneut seit dem Wiedereinzug der FDP seit 2017 an. Der studierte Politikwissenschaftler errang sein erstes Abgeordnetenmandat bereits mit 21 Jahren, als er im Jahr 2000 über die Landesliste in den Landtag seines Heimatlandes Nordrhein-Westfalen einzog. Dem Landtag gehörte er dann bis 2009 und erneut von 2012 bis 2017 an. Der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist er seit langem verbunden. Nach dem Abitur leistete Lindner seinen Zivildienst in der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach.
freiraum #59