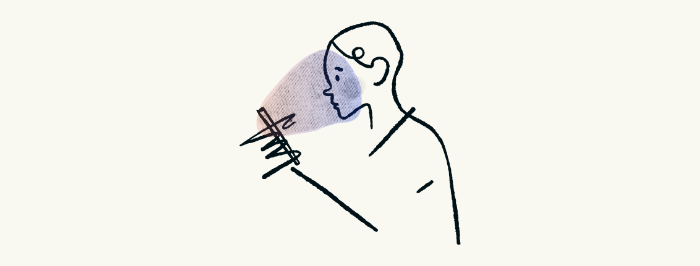Maximilian Sepp im Gespräch mit Ingvill Bryn Rambøl, Pressesprecherin und Informationschefin des Museums über den Friedensnobelpreis in Oslo, das jedes Jahr über 250 000 Besucher und mehr als 700 Schulklassen empfängt.
Interview
Wer schon einmal in Oslo war, hat sich sicherlich auch den Hafen angeschaut. Am großen Backstein-Rathaus vorbei, direkt am Beginn der bekannten Promenade »Aker Brygge« fällt ein leuchtend gelbes Gebäude mit zwei Türmen und einer großen Goldmünze über dem Eingang ins Auge – das Nobel Friedenscenter. Unter den Augen und Logos aller bisherigen Friedensnobelpreisträger, die in der Eingangshalle auf bunten Glasscheiben von der Decke hängen, treffe ich Ingvill Bryn Rambøl. Gemeinsam setzen wir uns in das Museumscafé und unterhalten uns über Frieden, Freiheit, Menschenwürde und den Friedensnobelpreis.
freiraum: Sie selbst, die Mitarbeiter des Museums und der Nobel Stiftung und nicht zuletzt auch die Preisträger widmen ihr Leben dem Kampf für Frieden und Freiheit. Ist dieser Kampf realistisch oder rein idealistisch?
Rambøl: Wir als Institution können versuchen, unseren Teil nur so gut wie möglich dazu beizutragen. Wir können nicht am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen: Die Welt ist heute nicht zu einem friedlichen Ort geworden, deshalb bin ich gescheitert. Das wäre sehr deprimierend. Aber wir können einen tatsächlichen Einfluss auf unsere Besucher haben. Wir können Schüler zum Beispiel dazu inspirieren, zum ersten Mal über Menschenrechte zu sprechen. Wir können Menschen dazu bringen, über Themen nachzudenken, an die sie vielleicht noch nie zuvor gedacht haben. Wir versuchen unseren Besuchern ein emotionales Erlebnis zu bieten. Antwort
Sie erzählen der Welt die Geschichte des Kampfes für den Frieden. Aber warum hier in Oslo? Die anderen vier Nobelpreise werden doch in Stockholm vergeben.
Richtig. Als Alfred Nobel starb, hinterließ er ein Testament, in dem stand, dass sein Vermögen für die Vergabe von Preisen in fünf verschiedenen Kategorien verwendet werden sollte. Damit sollten diejenigen ausgezeichnet werden, die im vergangenen Jahr »der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben«. Eine dieser Kategorien war der Frieden. Der Friedenspreis ist der einzige, der in Norwegen vergeben wird, so steht es in Nobels letztem Willen – allerdings bleibt er einer Erklärung schuldig. Als er starb, war Norwegen in einer Union mit Schweden, wir hatten also den gleichen König. Einige Leute sagen, dass Norwegen bereits damals eine diplomatische Rolle in der Welt hatte, im Gegensatz zu Schweden. Andere Leute sagen, dass der Friedenspreis damals im Vergleich zu den anderen Wissenschaftspreisen am wenigsten wichtig war – aber diese Erklärung mögen wir nicht (lacht). Nobel entschied dann, dass ein vom norwegischen Parlament gewähltes Komitee aus fünf Personen entscheiden solle, wer den Preis erhält. Und so ist es auch heute noch.
Würden Sie sagen, der Friedenspreis hat immer noch eine besondere Bedeutung unter den Nobelpreisen?
Definitiv, dem Friedenspreis wird heute in der Öffentlichkeit viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den anderen Preisen. Er wurde als die »prestigeträchtigste Auszeichnung« der Welt bezeichnet. Er hat die Macht, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf ein Thema zu lenken. Ich glaube nicht, dass sich Nobel damals die Kraft vorstellen konnte, die er heute hat.
Hat der Preis selbst auch direkte Folgen für die Ausgezeichneten, neben der öffentlichen Aufmerksamkeit?
Ich habe diese Frage bereits vielen Preisträgern gestellt. Die meisten von ihnen haben gesagt, dass die Auszeichnung sehr viel für sie und ihr Anliegen bedeutet hat. Als Friedensnobelpreisträger werden Sie zu vielen internationalen Konferenzen eingeladen und lernen wichtige Leute kennen. Aber Folgendes ist paradox: Viele Preisträger kämpfen weiterhin um finanzielle Unterstützung, wie zum Beispiel unser letztjähriger Preisträger ICAN. Der Friedensnobelpreis ist also keine schnelle Lösung für eine Finanzierung.
Die Leute engagieren sich also nicht automatisch für die Projekte, die den Friedensnobelpreis erhalten?
Leider nicht, aber da fängt unsere Arbeit an. Das Friedenscenter will Menschen einbeziehen und ein Engagement schaffen. In unserer aktuellen Fotoausstellung über verwehrte oder genommene Freiheit können sie zum Beispiel Postkarten für die auf den Fotos gezeigten Personen unterschreiben, die später an diese Personen geschickt werden. Wir wollen, dass die Besucher ihr Gefühl der Hoffnungslosigkeit in eine Motivation zur Veränderung verwandeln.
Die Situation der Preisträger verbessert sich also nicht immer durch die Auszeichnung und die Aufmerksamkeit?
Für einige der Preisträger hat sich die Situation nach dem Preis nicht verbessert. Zum Beispiel für Carl von Ossietzky, einem deutschen Journalisten, der als Herausgeber einer Zeitung von den Nazis ins Gefängnis und ins KZ gesteckt wurde, weil sie ihn einen Staatsfeind und Spion nannten. Oder Liu Xiaobo, der chinesische Schriftsteller, dem die Ausreise verboten wurde und der nach der Preisverleihung inhaftiert starb.
Diese beiden Preise gelten aber dennoch als zwei der wichtigsten in der Nobelgeschichte. Das ist es, was der Friedensnobelpreis bewirkt. Für die einen dauert die Wirkung sehr lange, für die anderen mag sie früher nachlassen, aber der Preis ist immer eine Anerkennung der Arbeit auf der globalen Bühne. Die ganze Welt hört auf die Preisträger, nachdem sie den Friedensnobelpreis erhalten haben.
Wie würden Sie die Verbindung zwischen Frieden und Freiheit einschätzen?
Es ist leicht zu sagen: »Du kannst keinen Frieden ohne Freiheit haben und keine Freiheit ohne Frieden«. Aber es ist nicht vollständig richtig. Manchmal, wenn Menschen für Freiheit kämpfen, endet der Frieden. Und dann muss man sich fragen, was wichtiger ist.
Wie entscheidet das Nobel-Komitee, welches Thema in diesem Jahr am wichtigsten ist oder wer ausgezeichnet werden müsste?
Manchmal zeichnet das Komitee eine bestimmte Person oder Organisation aus, um einem Thema zu helfen, schnellere Fortschritte zu machen. Manchmal ist es mehr eine Belohnung für einen erfolgreichen Prozess oder einen lebenslangen Einsatz.
Es wurde in der Vergangenheit aber viel kritisiert, dass die Entscheidungen zu politisch oder in eine bestimmte Richtung geleitet waren. Zum Beispiel die Auszeichnung von Barack Obama, der nur kurze Zeit nach seiner Wahl zum Präsidenten den Preis erhielt.
Wenn man als die renommierteste Auszeichnung der Welt bezeichnet wird, ist es selbstverständlich, dass die Entscheidungen immer viel kritisiert und diskutiert werden – und so sollte es auch unbedingt bleiben.
Glauben Sie, dass gerade eher der Frieden oder der Hass auf der Welt zunimmt?
Ich kann das nur aus persönlicher Sicht beantworten. Ich denke, dass in den öffentlichen Debatten heutzutage der Hass stärker sichtbar ist, vor allem in den Sozialen Medien. Aber er war schon immer da. Hass ist ein schwieriges Wort – es ein Gefühl ist und man kann ihn nicht wirklich messen.
Und was ist mit dem Frieden?
Nun, Frieden ist auch ein schwieriges Wort. Es braucht mehr als nur die Abwesenheit von Krieg, um Frieden zu schaffen. Das sieht man zum Beispiel in Kolumbien, wo es zwar einen Friedensvertrag gibt, aber auch noch einen langen Weg bis zum Frieden.
Ist die Welt von der Zeit Nobels bis heute ein besserer Ort geworden?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt viele Statistiken, die besagen, dass die Welt ein besserer Ort wird: Mehr Kinder kommen an Bildung, die Zahl der Armen nimmt insgesamt ab. Aber in wichtigen Bereichen gibt es auch Rückschläge. Die Arbeit für Frieden und Dialog ist wichtiger denn je.
Können Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Blick in die Glaskugel werfen und Probleme nennen, die noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommen?
In dieser Hinsicht halte ich unsere diesjährigen Preisträger für ein spannendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Geschichten der Frauen im Krieg zu hören und ihnen eine Rolle bei der Konfliktlösung zu geben. Nadia Murad hat schreckliche Erfahrungen als Gefangene von ISIS gemacht. Aber sie sagte, was sie will, ist nicht Hass – sondern Gerechtigkeit. ■
freiraum #60