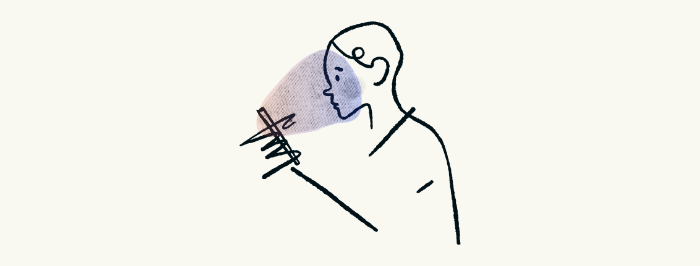Wenn wir normativ sprechen, drohen wir indirekt mit Gewalt. Wer andere als Individuen respektieren will, sollte darauf verzichten – und würde so auch die gesellschaftliche Debatte beflügeln. Von Timo Bremer
Schwerpunkt
Es scheint mir, als ob jedes Mal, wenn neue Informationstechnologien Debatten einer größeren Anzahl von Personen zugänglich machen und so die Frequenz, mit der neue Ideen generiert werden, wie auch der Grad der Spezialisierung und Wissensteilung steigt, althergebrachte Denkmuster und Weisheiten innerhalb kürzester Zeit durch eine Vielzahl neuer Hypothesen und Erkenntnisse in Frage gestellt werden. Auch bisherige Experten und Institutionen, deren Positionen zur Orientierung dienten, weil sie einen gewissen Ruf und eine gewisse Autorität hatten, verlieren dann einen großen Teil des ihnen entgegen gebrachten Vertrauens. Es dauert eine Weile, bis sich, aus einer Zeit allgemeiner Verwirrung, wieder eine klarere Hierarchie von Ideen, Experten und Institutionen herauskristallisiert.
Während solcher Phasen der Geschichte, in denen der Buchdruck, die Verbreitung von Universitäten, der Rundfunk oder jetzt das eine Erkenntnisexplosion verursachen und den »sense-making«-Prozess unserer Gesellschaft revolutionieren, kommt es daher zu einer Blüte von neuen Denkschulen und Ideologien, die versuchen, in dieser allgemeinen Unsicherheit eine neue, universelle Entscheidungs- und Orientierungshilfe zu sein.
Im Wettbewerb der Ideen um Aufmerksamkeit und Deutungshoheit, in dem es sich auszahlt, Gewissheit auszustrahlen, kommen dabei viele Schlüsse verfrüht. Da kaum noch etwas wirklich abwegig scheint und der Kampf um die Herzen der Menschen sich intensiviert, gewinnen oft illusorische, realitätsverleugnende Extrempositionen an Anziehungskraft. So wird einiges probiert, was besser niemand je probiert hätte, und im Umgang mit anderen Denkschulen und alten Autoritäten einiges verworfen, was besser nie verworfen worden wäre. Die so polarisierte und durch Unsicherheit und Angst emotionalisierte Debatte kann zudem ein der Erkenntnis abträgliches Klima schaffen und sogar selbst zu Hass und Gewalt führen.
Je intensiver diese unvermeidliche Phase gesamtgesellschaftlicher Verunsicherung und Verwirrung ausfällt, umso wichtiger ist es deshalb, die Debatte so produktiv wie möglich zu gestalten und gerade auch sehr konträre Positionen immer wieder direkt, aber auf eine respektvolle, entemotionalisierende und deeskalierende Art und Weise gegenüber zu stellen. Ich glaube, dass Respekt eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt, und dass wir Liberale, die wir vertraut sind mit österreichischen Vorstellungen von individuellem Wissen, dem Entdeckungsprozess und die das Individuum in seiner Entscheidungsfindung schon jetzt besonders respektieren, dazu einen großen Beitrag leisten können. In diesem Text möchte ich diese Chancen mit Bezug auf das extremste und drängendste Problem, nämlich das von Wut, Hass und daraus resultierender Aggression ausloten.
Ich glaube, dass Wut und Aggressionen immer und überall aus der gleichen, einzigen Quelle unterschiedlicher normativer Vorstellungen stammen. Wer eine normative Vorstellung hat, wem also etwas (zum Beispiel Fleischkonsum) als ein großes Übel (vielleicht für Umwelt, Lebensmittelpreise und Tierwohl) erscheint, der erbringt oft auch große persönliche Opfer, um es selbst zu vermeiden und auch sein Umfeld zu einer Reduktion zu bewegen. Durch diese Anstrengungen wird dann jemand, der sich, scheinbar trotz besseren Wissens, mutwillig gegenteilig verhält und vielleicht sogar durch extremes Verhalten (zum Beispiel dem ausschließlichen Verzehr von Fleisch) eigenhändig sämtliche eigene Bemühungen zu negieren scheint, leicht nachvollziehbar das Objekt von Wut, die sich auch in Aggressionen entladen kann.
Die Position »alle Menschen sollten X tun (oder lassen)« schließt ein »ich möchte, dass alle X tun (oder lassen)« und damit auch für jeden einzelnen ein »ich möchte, dass du X tust (oder lässt)« ein. Sie äußert einen Willen bezüglich des Verhaltens anderer; ist eine Art versteckter Befehl. Jeder, der sich gegenteilig verhält, kommt diesem dringlich-aufrichtigen, klar geäußerten und begründeten Wunsch bewusst nicht nach und erscheint dem Wünschenden damit von ruchlosen, wahrscheinlich selbstsüchtigen Interessen geleitet.
Für die Mitmenschen auf der anderen Seite erzeugt solch ein Befehl ohne klar definierte Sanktionen Unsicherheit. Jeder kann weiter tun was er will, muss aber damit rechnen, die betreffende Person gegen sich aufzubringen, ja bei wiederholtem, allzu unbekümmertem und damit automatisch provozierendem Verstoß sogar Gewalt von ihr zu erfahren. Diese versteckten Drohungen sind der Grund, warum die meisten Menschen ein solches Spiel, solange der Aufwand für sie gering ist, meistens mitspielen, und willensstarke Minderheiten es auf diese Weise schaffen, in der ganzen Bevölkerung bestimmte Verhaltensweisen oder Meinungen praktisch komplett zu eliminieren.
Liberale haben, von Rand bis Hayek, immer wieder darauf hingewiesen, was implizite und explizite Denk- und Handlungsverbote (kratisches statt katallaktisches Handeln) anrichten können. Im intellektuellen wie auch im volkswirtschaftlichen Entdeckungsprozess braucht es weitestmögliche Autonomie der einzelnen Akteure, um lokales Wissen zu nutzen, Hypothesen zu testen, sowie um einen hohen Grad der Wissensteilung und Spezialisierung zu erreichen. Die Entscheidung wider besseren Wissens, die jedes Mal fällt, wenn ein zentraler Befehl oder ein gesellschaftliches Tabu wirksam werden, lähmt nicht nur den Fortschritt, sie führt auch zu Fehlentwicklungen, die grausame Ausmaße annehmen können. Jedes Mal, wenn man einer fehlerhaften Hypothese das Scheitern verweigert, in dem man sie nicht an der kalten Wahrheit ihres isolierten Ergebnisses bewertet, entfernt man sich einen weiteren Schritt von der Realität und damit von Wahrheit, evolutionärer Fitness und einem unsere Werte maximierenden System.
Wenn es dagegen gelänge, verschiedene normative Vorstellungen ohne implizite Drohungen, sondern mit Respekt vor jedem einzelnen und seiner gesellschaftlichen wie individuellen Pflichtzu kommunizieren, würden solche Tendenzen vermieden und die Debatte könnte sehr viel zielgerichteter ablaufen.
Das ist weder utopisch, noch nie dagewesen. In der Vergangenheit haben sich ganze Grammatiken aus solch respektbasiertem Umgang entwickelt. Am Hof von Königen und Kaisern gab es jeden Tag die Schwierigkeit, normative Vorstellungen gegenüber Respektspersonen zu äußern, ohne dabei in die Verlegenheit zu kommen, den Eindruck zu erwecken, einen (auch noch so versteckten) Befehl zu erteilen. Dort hat es sich bewährt, den Adressaten zum Objekt zu machen, also über, statt zu ihm zu sprechen. Im Englischen wurde das »Euchzen« so dominant, dass »euch« (»you«) heute das einzig verbliebene Personalpronomen ist, um Einzelpersonen zu adressieren. Auch im deutschen Sprachraum fand es in Form von »Eure Majestät«, »Eure Hoheit« oder »Eure Heiligkeit« weite Verbreitung.
Wenn man eine Person »euchzt«, verbietet es sich schon aus den grammatikalischen Regeln heraus, von »sollen« oder »müssen« zu sprechen. Stattdessen ist der Sprecher gezwungen, jeden Wunsch zu begründen, und dabei die Auswirkungen für den Adressaten, als das Satzobjekt, in den Mittelpunkt zu stellen. Aus »Ihr solltet ein Bad nehmen« wird: »Es könnte Eure Chancen auf die Zuneigung Eurer Gemahlin verbessern, ein Bad zu nehmen.« Damit wird der Adressat, mit seinem individuellen Wissen und seiner Pflicht diesem zu folgen, und damit sich und sein Umfeld in eine positive, an der Realität orientierte Richtung zu entwickeln, respektiert. Der Sprecher wiederum wird dazu gezwungen, in dem was er möchte, die Vorteile für den Anderen zu suchen und so, in bester spieltheoretischer Manier, eine beiderseitig vorteilhafte, selbsterhaltende (self-enforcing) Kooperation vorzuschlagen. Das erhöht nicht nur die Chance, dass er seinen Willen bekommt, sondern führt ihm auch vor Augen, welche guten Gründe der Adressat eventuell dafür hat beziehungsweise welche ihm vielleicht dafür fehlen, seinem Wunsch Folge zu leisten. Es schafft so Verständnis für abweichendes Verhalten. So schafft es gesellschaftlich wichtiges Vertrauen, das als Basis weiterer Kooperation dienen kann. Die Diskussion wird von der emotionalen, normativen Ebene auf die Sachebene gezogen, in der die Ausgangssituation und die Zielvorstellungen des Handelnden in ein überzeugendes Plädoyer dafür eingebunden werden wollen, warum eine bestimmte Handlungsoption für ihn die beste ist.
Ob eine Rückkehr zum »euch« tatsächlich zweckmäßig ist, mag ich nicht zu beurteilen. Wenn aber allein schon der im »euch« ausgedrückte Respekt zur Norm würde und die ständigen, versteckten Gewaltdrohungen aus unserer Debatte verschwänden, bin ich mir sicher, dass die gesellschaftliche Debatte weit weniger von Hass und mehr von Einsicht und konstruktiven Lösungsvorschlägen geprägt wäre. Wir sollten es nicht akzeptieren, dass Menschen mit normativen Vorstellungen und Wertungen um sich werfen und sich mit den so geäußerten Forderungen aufführen wie Despoten, denen alle anderen zu gehorchen haben. Einen Teil davon bringt die amerikanische Regel »don’t judge« zum Ausdruck, aber vielleicht wäre eine noch bessere Regel: »Du sollst nicht »soll« sagen (geschweige denn »muss«)«.
Ich bin mir bewusst, dass ich, auf scheinbar scheinheilige Art und Weise, eine normative Vorstellung über normative Vorstellungen geäußert und ein Tabu für Tabus gefordert habe. Ich selbst nehme eine unklare Androhung von Gewalt in den Mund, wenn ich fordere, dass man nicht auf eine bestimmte, respektlose Art zu einander sprechen solle. Bei direkter, physischer Gewalt hat sich diese Erkenntnis allerdings schon lange durchgesetzt, dass die einzige legitime Form solcher Gewalt die ist, die Gewalt verhindert. Dazu dient, im Idealfall, das Gewaltmonopol oder das Recht auf Selbstverteidigung. Ich denke es ist Zeit, denselben Schluss auch für sprachliche Androhung von Gewalt zu ziehen, und das Tabu, das Tabus verhindert, zum einzig legitimen Tabu zu machen. Das wäre in seiner Motivation, größeren Respekt für das Individuum zu schaffen, in seiner Auswirkung, friedsame, gegenseitig vorteilhafte Kooperation zu fördern, und in seiner Umsetzung – durch die Zivilgesellschaft statt durch die Staatsgewalt – liberal und würde einen idealen Gegenpol zur aktuellen, von Angst geprägten und repressiven Internet- und Medienpolitik der Europäischen Union (EU) und des Bundes schaffen. ■
freiraum #60